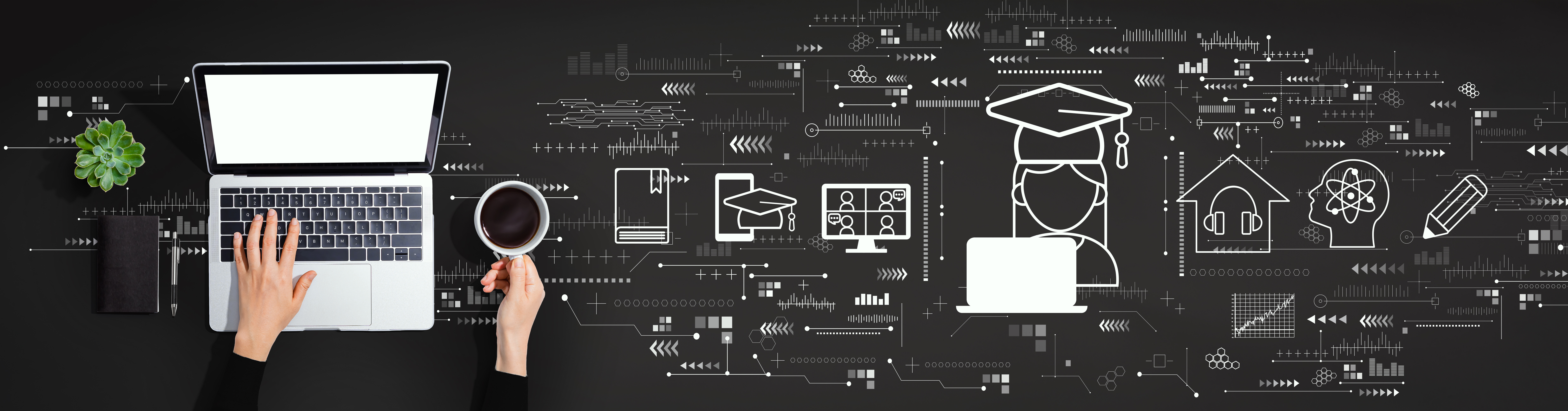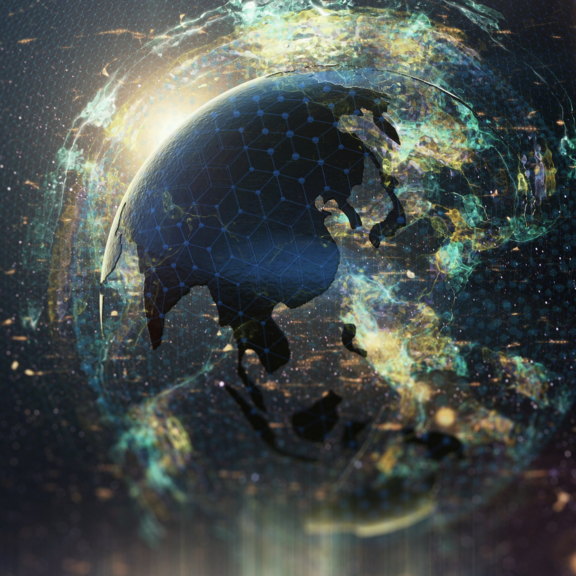21.07.2025
Vor einigen Monaten habe ich meine Führungskraft darum gebeten, mir eine Glaskugel auf Kosten des Arbeitgebers anzuschaffen. Denn allzu häufig werde ich gefragt: „Wie wird es mit KI in ein paar Jahren denn im Ausbildungsalltag eigentlich aussehen?“. Hinter dieser Frage stecken häufig sowohl Sorgen, nicht zuletzt um den eigenen Arbeitsplatz, aber auch der Wunsch, die Zukunft aktiv zu gestalten und heute die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
Die Zukunft ist ungewiss
Ausbilder:innen haben immer ein Auge in die Ferne gerichtet, häufig in Rücksprache mit Führungskräften von Fachabteilungen in mittleren und großen Unternehmen. „In 3 Jahren brauche ich fünf Werkzeugmechaniker, drei Feinwerkmechanikerinnen und zwei Industriekaufleute“. So oder so ähnlich spielen sich Gespräche jeden Tag in Besprechungsräumen in Deutschland ab. Keiner der Beteiligten dürfte dabei in eine Glaskugel schauen, sondern vielmehr versuchen Geschäftsprognosen und Personalkennzahlen für eine vernünftige Empfehlung zu nutzen. Manche verlassen sich vielleicht auch etwas auf das Gefühl. Aber natürlich bleibt immer ein gewisses Restrisiko.
Warum ist der Blick in die Zukunft so schwierig?
Als Forscher kenne ich genug Kolleg:innen, die wenig Interesse haben, sich mit dem zukünftigen Einfluss von KI auf dem Arbeitsmarkt zu beschäftigen. Das liegt zum einen daran, dass die Datenlage immer noch eher übersichtlich ist und eine vernünftige Empfehlung schwierig ist. Viele Forschungsergebnisse sind zudem nicht auf den deutschen Arbeitsmarkt übertragbar, und selbst dann meist nur für Berufe mit akademischem Hintergrund. Zugleich ist das aber auch nichts neues, da die starke berufliche Bildung in Deutschland in den meisten Ländern schlicht nicht Standard ist.
Bei KI kommt aber etwas hinzu. Denn viele Forscher:innen wurden von generativer KI schlicht und einfach überwältigt und haben die Entwicklung nicht kommen sehen. Ich habe den Eindruck, dass dies in den Betrieben ein bisschen anders gelaufen ist. Auch dort wären wohl die Wenigsten auf die Idee gekommen, dass sie in einigen Jahren mit einem Chatbot besprechen, wie sie die Einführungswoche für ihre neuen Azubis gestalten. Zugleich gab es aber gerade in der Industrie bereits zahlreiche Anwendungsfälle der analytischen Intelligenz, etwa bei der Optimierung von Routen für die Lkw, der Wartung von Maschinen oder der maschinellen Prüfung von Produkten auf Fertigungsstraßen. Und natürlich werden diese Technologien auch in der Ausbildung vermittelt, denn das war mit den technologieoffenen Ausbildungsordnungen und etwas gutem Willen kein Problem.
Lohnt sich eine Investition in eine Arbeitswelt mit KI?
Eine große Hoffnung in vielen Unternehmen ist ein Produktivitätsgewinn durch künstliche Intelligenz. Das heißt, dass Mitarbeitende durch KI ihre Arbeit schneller und besser gestalten können. Eine aktuelle und repräsentative Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft gibt Aufschluss, ob das zwischen 2022 und 2024 aus Sicht von Beschäftigten auf dem deutschen Arbeitsmarkt bereits der Fall war. Dabei berichten Beschäftigte, die schon länger in ihrem jeweiligen Unternehmen KI nutzen, häufiger von einer gestiegenen Arbeitsleistung als Beschäftigte, die nicht mit KI gearbeitet haben. Zugleich zeigt sich aber auch die Notwendigkeit, sich erst einzuarbeiten und die Herausforderung, dass zu Beginn der Umstellung auch erst mal die Produktivität sinken kann. Es erscheint daher denkbar, dass der Fortschritt an Produktivität am Arbeitsplatz durch KI weniger gerade nach oben verlaufen könnte, sondern durch Rüstzeiten für den Umgang mit neuer Technologie wellenförmig beeinflusst wird. Die Bedeutung von Bildungsverantwortlichen in Unternehmen könnte dadurch wachsen, nicht zuletzt, weil sie spontan auf neue Entwicklungen im KI-Bereich reagieren müssten. Und für Auszubildende wird das lebenslange Lernen mehr denn je ein zentraler Bestandteil der beruflichen Handlungskompetenz.
Ausbilder:innen als Zukunftsgestalter
So stark wie nie zuvor werden Ausbilder:innen durch KI Zukunftsgestalter werden. Denn mit den Kompetenzen, die sie heute vermitteln, müssen sie junge Menschen nicht nur auf eine Welt in drei-fünf Jahren vorbereiten. Vielmehr ist es die Vorbereitung auf eine Arbeitswelt, wo nicht zuletzt durch KI, Veränderungen immer und immer wieder auftreten können. Umso wichtiger ist es, schon in der Ausbildung den Umgang mit Wandel aktiv zu trainieren – sei es an realen Arbeitsprozessen oder im Rahmen von Projekten, in denen Auszubildende ihre eigenen Ideen zur Rolle von KI im Arbeitsalltag entwickeln.
Haltung und Lernkultur sind entscheidend
Dabei kommt es nicht nur auf Methoden und Inhalte an, sondern auch auf Haltung und Kultur. Wenn Auszubildende erleben, dass es selbstverständlich ist, sich gegenseitig über den Einsatz von KI auszutauschen und voneinander zu lernen – sei es in festen Formaten oder ganz informell im Arbeitsalltag („Hey XY, hast du Lust kurz vorbeizuschauen ich habe heute folgendes herausgefunden) – kann das langfristig ein Fundament für produktives, technologieoffenes Arbeiten legen. So können Rüstzeiten niedrig und die Produktivität hoch gehalten werden. Ausbilder:innen können diese Haltung vorleben und zugleich in den jeweiligen Fachabteilung dafür werben, dass sie Teil der internen Weiterbildungskultur wird. So können Auszubildende mittelfristig zu Wegbereiter:innen des technologischen Wandels im Betrieb werden.
KI und berufliche Bildung: Teilhabe für alle ermöglichen
Natürlich werden sich nicht alle Auszubildenden im gleichen Tempo beteiligen können. Eine große Stärke der beruflichen Bildung ist ihre Offenheit für Menschen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen. Menschen mit Lernbehinderung benötigen zum Beispiel teilweise zusätzliche Unterstützung, wie eine angepasste Vermittlung oder zusätzliche Zeit, bedürfen, um Kompetenzen im gleichen Ausmaß zu erwerben. Aber auch sie können von KI profitieren, wenn sie z. B. bereits in der Ausbildung lernen, wie sie ein Large-Language-Modell nutzen können, um Fragen zu stellen oder Informationen verständlich aufzubereiten. So kann KI dabei helfen, individuelle Teilhabe zu stärken – und die Rolle von Ausbilder:innen als Ermöglicher:innen dieser Teilhabe wächst weiter.
Und hier sehe ich auch die Chance wie Forscher:innen Praktiker:innen Unterstützung anbieten können. Nicht als Orakel einer fernen Zukunft, sondern als Impulsgeber und Sparringspartner bei der Entwicklung von Lösungen. Das Netzwerk Q 4.0 kann dabei ein Raum sein, sich auszutauschen.
PS: Meine Führungskraft hat mir übrigens immer noch keine Glaskugel bewilligt. Und ich glaube daran wird auch dieser Beitrag nichts ändern. Aber vielleicht ist es auch okay ohne Hokus Pokus mit etwas Unsicherheit zu leben, ob in der Forschung oder als Praktiker:in in der beruflichen Bildung.
Quelle: Hammermann, Andrea / Monsef, Roschan / Stettes, Oliver, 2025, Produktiver mit KI?. Wie Unternehmen und Beschäftigte die Produktivitätseffekte einschätzen, in: IW-Trends, 2024, 51. Jg., Nr. 4, S. 75-94