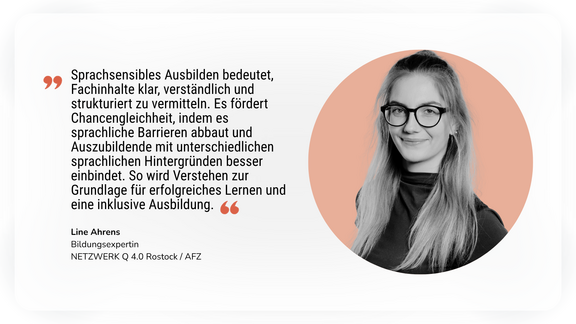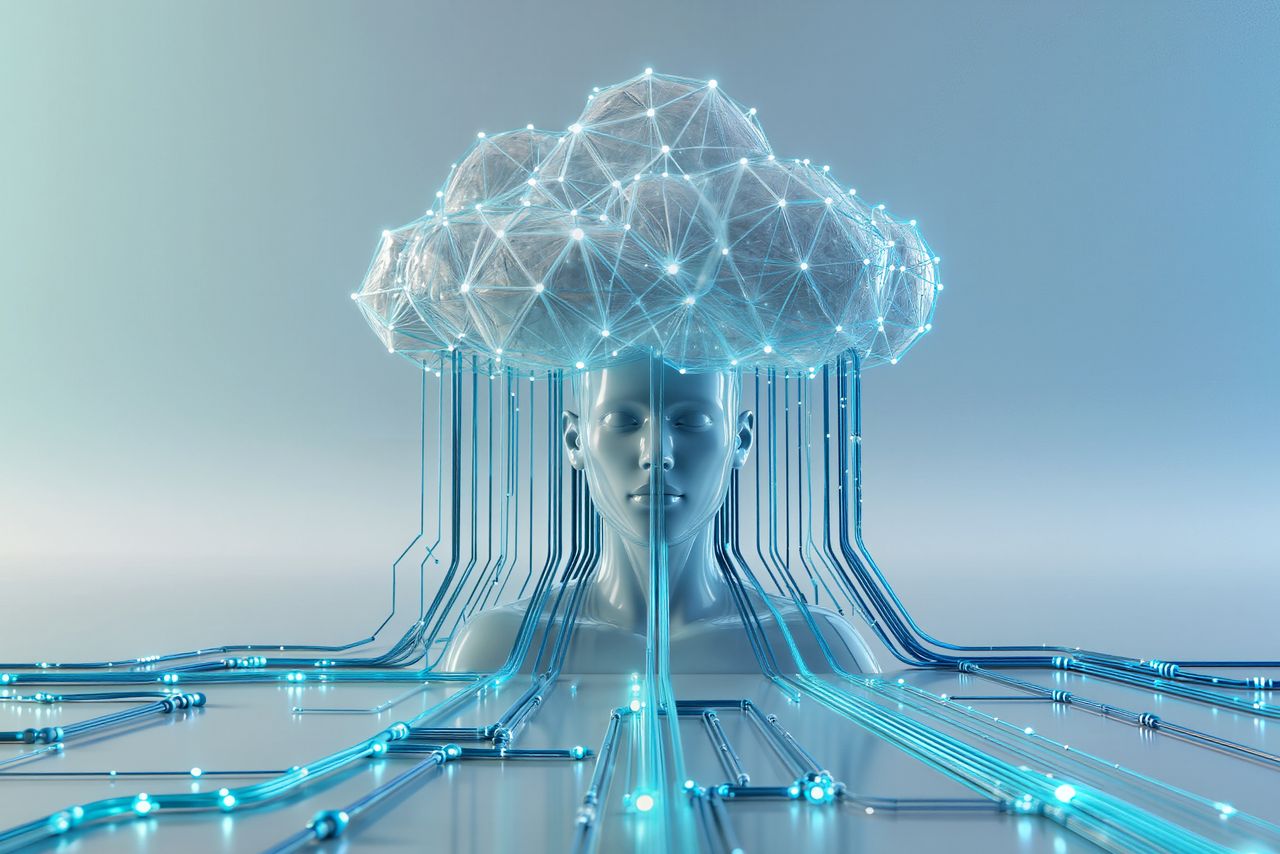6. Mai 2025
Wenn Fachbegriffe unverständlich bleiben oder Anweisungen zu kompliziert formuliert sind, entstehen schnell Unsicherheiten – vor allem für Lernende, die noch nicht sicher in der Bildungssprache sind. Der Blogbeitrag zeigt anhand konkreter Beispiele, wie Ausbilderinnen und Ausbilder mit sprachbewusstem Handeln Barrieren abbauen können: durch klare Sprache, gezielte Erklärungen und den sensiblen Umgang mit verschiedenen Sprachebenen. So wird Lernen verständlicher, Kommunikation inklusiver – und Ausbildung für alle zugänglicher.
Einleitung: Warum ist Sprache in der Ausbildung so wichtig?
In Ausbildungsklassen kommen Menschen mit unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen, Bildungserfahrungen, Muttersprachen und Förderbedarfen zusammen. Gerade in der Berufswelt, in der Fachsprache und komplexe Begriffe eine große Rolle spielen, kann diese sprachliche Vielfalt zur Herausforderung werden: Fachbegriffe wirken abschreckend, unklare Anweisungen sorgen für Unsicherheit, und schriftliche Prüfungen werden zur Hürde. Dabei ist Sprache der Schlüssel zu Wissen – und damit auch zum beruflichen Erfolg. Sprachsensibles Handeln kann den Ausbildungsalltag erleichtern.
Was bedeutet Sprachsensibilität in der Ausbildung?
Sprachsensibles Handeln bedeutet, Sprache gezielt und reflektiert einzusetzen, um Lernenden den Zugang zu Wissen zu erleichtern. Dabei geht es nicht darum, Fachsprache zu vermeiden oder Inhalte übermäßig zu vereinfachen. Vielmehr sollen Fachbegriffe gezielt erklärt und in den Lernprozess integriert werden. So können Lernende berufliche Situationen sprachlich sicherer bewältigen – mündlich wie schriftlich.
In der Ausbildung sind drei Sprachebenen von Bedeutung:
Alltagssprache – die Sprache, die Lernende aus ihrem täglichen Umfeld kennen.
Bildungssprache – die Sprache des schulischen und akademischen Lernens.
Berufsfachsprache – die spezifische Sprache eines Fachbereichs oder Berufs.
Während die Alltagssprache meist intuitiv erlernt wird, müssen Bildungssprache und Berufsfachsprache gezielt vermittelt und geübt werden. Besonders in der Ausbildung treffen diese verschiedenen Sprachebenen aufeinander und vermischen sich – etwa, wenn Fachbegriffe im beruflichen Kontext mit alltagssprachlichen Erklärungen verständlich gemacht werden. Sprachsensibler Unterricht hilft dabei, diese Übergänge bewusst zu gestalten.
Vorteile von sprachsensiblem Unterricht in der Ausbildung
Erleichtertes Lernen: Klare und strukturierte Sprache reduziert Missverständnisse und hilft, komplexere Inhalte besser zu erfassen.
Mehr Chancengleichheit: Eine sprachsensible Ausbildung sorgt dafür, dass alle Zugangsmöglichkeiten zu Wissen und Bildung haben, unabhängig von ihrer sprachlichen Vorbildung.
Stärkung der Selbstwirksamkeit: Wer Inhalte versteht, fühlt sich sicherer, kann sich gezielt einbringen und selbstbewusster kommunizieren.
Höhere Motivation: Verständliche Erklärungen sorgen für Erfolgserlebnisse und steigern die Lernfreude.
Förderung der Integration: Sprache ist der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Ein bewusster Umgang mit Sprache stärkt interkulturelle Kompetenzen und verbessert die Kommunikationsfähigkeiten.
Typische Probleme in der Ausbildung
Berufsfachsprache vs. Alltagssprache: Fachbegriffe ohne Erklärungen können abschreckend wirken. Zudem haben viele Begriffe im Alltag eine andere Bedeutung als im beruflichen Kontext (z. B. Presse in der Medienbranche vs. in der Metallverarbeitung).
Komplexe Satzstrukturen und abstrakte Formulierungen: Lange, verschachtelte Sätze oder stark theoretische Beschreibungen erschweren das Verständnis und die praktische Anwendung des Gelernten.
Unterschiedliche Sprachkompetenzen in einer Gruppe: Während einige Lernende bereits sicher mit Fachsprache umgehen, benötigen andere zusätzliche Unterstützung. Der Spagat zwischen individueller Förderung und einheitlichem Unterricht ist oft schwer zu bewältigen.
Strukturelle Herausforderungen: Zeitmangel, curriculare Vorgaben und personelle Ressourcen schränken die Möglichkeiten individueller Förderung ein.
Sprachliche Barrieren für Nichtmuttersprachler*innen: Lernende mit Deutsch als Zweitsprache tragen in der Ausbildung eine doppelte Last: Sie müssen gleichzeitig ihre allgemeinen Sprachkenntnisse ausbauen und berufsspezifische Fachsprache verstehen – oft unter Zeitdruck. Unsicherheiten im Ausdruck, Nachfragen oder Redepausen sind dabei natürliche Schritte im Lernprozess.
Mangelndes Bewusstsein für Sprachbildung: Sprache wird oft nicht als Querschnittsaufgabe aller Fachbereiche gesehen, sodass gezielte Maßnahmen zur Sprachförderung fehlen oder nur unzureichend umgesetzt werden.
Sprachsensible Methoden und Tipps für den Ausbildungsalltag
Klare und verständliche Sprache nutzen
Kurze, prägnante Sätze und aktive Formulierungen vermeiden Missverständnisse.
Fachbegriffe gezielt einführen: Begriffe erklären, in den Kontext setzen und mit Alltagssprache verknüpfen.
Verschiedene Lernzugänge ermöglichen
Wechsel der Darstellungsformen: Inhalte mündlich, schriftlich und visuell vermitteln.
Einsatz digitaler Tools: Interaktive Lernplattformen, digitale Wörterbücher, Übersetzungs- und Vorlese-Apps sowie der Einsatz von KI-Tools können den individuellen Lernprozess unterstützen.
Lernende aktiv einbinden
Interaktive und kooperative Methoden nutzen: Gruppenarbeiten, Peer-Teaching und Reflexionsrunden fördern die sprachliche Kompetenz.
Lernpartnerschaften: Unterschiedlich sprachlich erfahrene Personen unterstützen sich im Team beim Lernen.
Praxisnahe Sprachübungen integrieren: Fachsprache in realen Arbeitssituationen üben, z. B. durch das Erklären von Arbeitsschritten oder Kundengespräche.
Struktur und Orientierung geben
Operatoren bewusst einsetzen: Verben wie analysieren, bewerten oder erklären geben Lernenden eine klare Orientierung, was genau von ihnen erwartet wird.
Scaffolding-Ansatz nutzen: Hilfestellungen wie Mindmaps, Wortschatzlisten, Übersetzungstabellen oder Formulierungshilfen bereitstellen und schrittweise reduzieren.
Material überprüfen: Sind Texte verständlich formuliert, Aufgaben klar strukturiert und unterstützende Erklärungen integriert?
Individuelle Unterstützung ermöglichen
Nachteilsausgleiche prüfen: Alternative Prüfungsformen und Leistungsbewertungen ermöglichen und ggf. längere Bearbeitungszeiten anbieten.
Förderangebote und Anlaufstellen nutzen: Bestehende Sprachförderprogramme und lokale Angebote in die Ausbildung integrieren.
Selbstreflexion und Bewusstsein stärken
Eigene Sprachverwendung und Erwartungen reflektieren: Wie verständlich sind meine Erklärungen? Wie oft gebe ich Lernenden die Möglichkeit, selbst zu sprechen? Gebe ich genügend Raum für Nachfragen?
Zudem lohnt es sich, eigene (unbewusste) Erwartungen und mögliche Vorurteile zu hinterfragen: Gehe ich automatisch davon aus, dass jemand mit Akzent weniger versteht? Verknüpfe ich Sprachsicherheit mit Fachkompetenz? Gerade in heterogenen Gruppen ist es wichtig, Unsicherheiten zu akzeptieren und eine offene, wertschätzende Lernatmosphäre zu schaffen.
Fazit: Ausbildungspersonal als Wegbereiter sprachsensibler Kommunikation
Sprachsensibilität ist ein entscheidender Erfolgsfaktor in der Ausbildung und unterstützt dabei, sprachliche Hürden abzubauen und eine inklusive Lernumgebung zu schaffen. Ausbilder*innen haben hier eine Schlüsselrolle: Sie sind sprachliche Vorbilder und beeinflussen maßgeblich, wie Lernende Fachsprache erwerben und sicher anwenden können.
Sprachsensibler Unterricht trägt nicht nur zur beruflichen Kompetenzentwicklung bei, sondern fördert auch interkulturelles Verständnis. Ein sprachsensibler Unterricht schafft somit eine Grundlage für mehr Bildungsgerechtigkeit und erhöht die Chancen der Lernenden auf langfristigen beruflichen Erfolg. Wer verstanden wird, lernt leichter – und wer leichter lernt, bleibt motiviert dabei.
Kompakte Infos zur Anwendung in der Praxis haben wir dir in diesem Cheat Sheet "Sprachsensibel ausbilden" (PDF) zusammengestellt.